
foto freepik ki
Das »Default Mode Network« (DMN) ist eine Gruppe von Hirnregionen, die aktiv sind, wenn wir nicht mit unserer Umgebung interagieren – zum Beispiel beim Tagträumen. Beim Lösen von Aufgaben hingegen ist dieses Netzwerk weniger aktiv. Jülicher Forscherinnen und Forscher haben die Struktur und Funktion dieses Netzwerks mit Hilfe von Gewebeanalysen und modernen bildgebenden Verfahren untersucht. Dabei konnten sie mikrostrukturelle Unterschiede identifizieren, die beeinflussen, wie das DMN mit anderen Hirnregionen kommuniziert. Die Ergebnisse der Studie wurden im Fachmagazin Nature Neuroscience veröffentlicht.
Das DMN umfasst unter anderem den Parahippocampus, das Precuneus, den mittleren Temporallappen und Teile des Frontallappens – Hirnregionen, die an Gedächtnis, Selbstwahrnehmung und der Verarbeitung von Erinnerungen beteiligt sind. Es ermöglicht das sogenannte reizunabhängige Denken (engl. stimulus-independent thought) – also kognitive Prozesse, die nicht durch äußere Sinnesreize ausgelöst werden. Dazu gehören neben Tagträumen auch Zukunftspläne oder das Nachdenken über Vergangenes, Zukünftiges, über die eigene Persönlichkeit und über soziale Interaktionen. Auch kreative Ideen entstehen oft in diesen Phasen der inneren Reflexion.
Aber auch bei anspruchsvolleren Denkaufgaben spielt das DMN eine Rolle und kann unter bestimmten Umständen durch äußere Reize beeinflusst werden. Genau das stellte die Neurowissenschaftler vor ein Paradoxon: Wie kann ein Netzwerk, das für reizunabhängiges Denken bekannt ist, gleichzeitig auf Sinneseindrücke reagieren? Eine Antwort liefert die neue Studie: Denn das DMN ist kein einheitliches System, sondern besteht aus unterschiedlich aufgebauten Bereichen. Einige sind stark mit sensorischen Hirnregionen vernetzt und können durch äußere Reize – etwa Geräusche oder Gerüche – angestoßen werden. Andere Teile sind dagegen stärker abgeschirmt und ermöglichen introspektive Gedanken, die aus dem Inneren heraus entstehen.
Wie das DMN Informationen verarbeitet
Die Forscher vom Institut für Neurowissenschaften und Medizin (INM-1 und INM-7) fanden heraus, dass die Architektur des Gehirns nicht nur seine Struktur, sondern auch seine Funktion bestimmt – von einfachen Wahrnehmungsprozessen bis hin zu komplexen kognitiven Leistungen. Die Erkenntnisse liefern wertvolle Hinweise darauf, warum manche Gedanken stark von Sinneseindrücken beeinflusst werden – etwa wenn ein bestimmter Duft Erinnerungen weckt oder ein Lied Emotionen hervorruft – und wie das DMN solche Reize in unsere innere Gedankenwelt übersetzen kann.
Die stark geschichteten Bereiche ähneln in ihrer Architektur den sensorischen Arealen des Gehirns, die für die Verarbeitung von Sinneseindrücken wie Sehen und Hören zuständig sind. Wie diese Areale bestehen auch sie aus mehreren spezialisierten Zellschichten, die unterschiedliche, komplexe Aufgaben übernehmen können. Einige Schichten empfangen Signale aus anderen Hirnregionen, andere sind für die Weiterleitung oder Verarbeitung dieser Informationen zuständig. Diese Organisation ermöglicht eine bessere Vernetzung mit anderen Hirnarealen und eine effizientere Verarbeitung von Sinnesinformationen.
Das erklärt, warum das DMN dann aktiviert wird, wenn äußere Reize wie Gerüche oder ein Lied Erinnerungen oder Emotionen auslösen. Die weniger geschichteten Bereiche sind hingegen stärker in sich geschlossen und weniger von der Außenwelt beeinflusst. Sie unterstützen introspektive Gedanken wie Tagträume oder Selbstreflexion, die durch interne Prozesse angestoßen werden.
Zwei Methoden für neue Erkenntnisse
Um die Struktur und Funktion des DMN genauer zu untersuchen, kombinierten die Forschenden zwei Methoden: detaillierte Gewebeanalysen verstorbener Personen und moderne bildgebende Verfahren bei lebenden Menschen.
Für die Gewebeanalysen wurden dünne Hirnschnitte unter dem Mikroskop untersucht. So wurden feine mikrostrukturelle Details sichtbar – zum Beispiel, wie die Nervenzellen in verschiedenen DMN-Regionen angeordnet sind, wie stark sie geschichtet sind und wie sie untereinander sowie mit anderen Hirnregionen vernetzt sind.
Bei den MRT-Scans am lebenden Menschen haben die Forschenden mit einer nicht-invasiven Methode die Struktur untersucht und die Aktivität des Gehirns gemessen, ohne dass ein Eingriff nötig war. So konnten sie sichtbar machen, welche Regionen des DMN besonders aktiv sind und wie sie mit anderen Hirnregionen kommunizieren.
Der Schlüssel lag in der Kombination dieser Methoden. Normalerweise können mit MRT allein keine so feinen Details der Gehirnstruktur erkannt werden. Durch den Vergleich mit echten Gewebeproben wurde jedoch sichtbar, dass bestimmte Muster der Nervenzellorganisation auch in lebenden Menschen eine Rolle spielen. Dadurch konnten die Wissenschaftler:innen nachweisen, dass bestimmte mikrostrukturelle Muster – wie die Schichtung der Nervenzellen – direkten Einfluss darauf haben, wie Informationen innerhalb des DMN verarbeitet und weitergeleitet werden. Zudem zeigte sich, dass sich viele dieser in Gewebeproben gefundenen Muster auch im lebenden Gehirn nachweisen lassen.
Weitere Informationen
-
Originalpublikation in Nature Neuroscience
-
Institut für Gehirn und Verhalten (INM-7)
-
Institut für Strukturelle und funktionelle Organisation des Gehirns (INM-1)
392 Artikel zu „Gehirn“
News | Digitalisierung | Kommunikation | Tipps
Fünf Gründe, warum Lesen auf dem Smartphone die Gehirnleistung steigert

»Lesen wird nie wieder dasselbe sein«, sagt Nathan Mercer, Connectivity Solutions Expert von Truely eSIM. Das Aufkommen des mobilen Lesens hat neue Möglichkeiten zur Steigerung der geistigen Stimulation eröffnet. Eine Umfrage des Pew Research Center zeigt, dass mittlerweile etwa drei von zehn Amerikanern E-Books lesen, was den Aufstieg und die Akzeptanz des digitalen Lesens…
News | Marketing
Wie Videospiele das Gehirn fördern können?

Zu den gängigsten Stereotypen über Videospiele zählen jene über ihre negativen Auswirkungen auf kognitiven Funktionen und Aggressionsniveau. Während Videospiele heute eher einem interaktiven Kino ähneln und sich stark von den Retrogames der 80er und 90er unterscheiden, genießen sie weiterhin einen schlechten Ruf und werden eher als Zeitverschwendung angesehen. Es ist die Zeit, mit diesem Stigma…
News | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 1-2-2021
Mit Deep-Learning-Methoden komplexe Informationen verarbeiten – Lernmuster menschlicher Gehirne nutzen
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Services
Smarte Helfer im Geschäftsalltag: KI-Gehirn für die Automatisierungs-Zombies
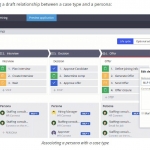
Anwendungen für die Automatisierung von geschäftlichen Vorgängen und Abläufen sind für Unternehmen von unschätzbarem Wert, weil sie Mitarbeiter entlasten. Doch vieles, was als »Smart Robot« bezeichnet wird, schöpft das Potenzial nicht aus – und ist eher ein Automatisierungs-Zombie. Wie können Unternehmen diese intelligenter und damit zu innovativen Helfern im Business-Alltag machen? Mit automatisierten Abläufen…
News | Digitalisierung | Kommunikation | Online-Artikel
Können Gedanken das Gehirn verändern?

Wissenschaftler*innen untersuchten den strukturellen Einfluss eines Brain-Computer-Interface auf die Hirnsubstanz. Die Wirkung eines sogenannten Brain-Computer-Interfaces (BCI, Gehirn-Computer-Schnittstelle) beruht darauf, dass die bloße Vorstellung einer Handlung schon messbare Veränderungen der elektrischen Hirnaktivität auslöst. Diese Signale können über ein EEG (Elektro-Enzephalographie) ausgelesen, ausgewertet und dann über maschinelle Lernsysteme in Steuersignale umgesetzt werden, die zum Beispiel einen Computer…
News | Trends 2019 | Künstliche Intelligenz
KI: Gehirne von Männern und Frauen unterscheiden sich

Forscher haben selbstlernende Software aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) erfolgreich darauf trainiert, zu erkennen, ob ein fMRT-Scan ein weibliches oder ein männliches Gehirn zeigt. Damit ist klar, dass es bei der Verknüpfung von Gehirnregionen charakteristische Geschlechtsunterschiede gibt. Nachzulesen ist dieses Ergebnis der Wissenschaftler aus Jülich, Düsseldorf und Singapur jetzt in der Fachzeitschrift »Cerebral…
News | Business | Digitalisierung | Infrastruktur | Lösungen | Rechenzentrum | Strategien
Bereit für Exascale: Forscher entwickeln Algorithmus für Gehirnsimulationen auf Superrechnern der nächsten Generation
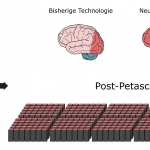
Das menschliche Gehirn mit seinen hundert Milliarden Nervenzellen ist ein Organ von ungeheurer Komplexität. Selbst mithilfe der schnellsten Superrechner ist es bis jetzt unmöglich, den Austausch von Gehirnsignalen in einem Netzwerk dieser Größe zu simulieren. Wissenschaftler des Forschungszentrums Jülich, des japanischen RIKEN-Instituts in Kobe und Wako und des schwedischen KTH Royal Institute of Technology in…
News | Digitalisierung | Kommentar | Kommunikation | Strategien | Tipps
Das Gehirn – ein Netzwerk voller Möglichkeiten

Dr. Henning Beck ist Biochemiker, Neurowissenschaftler und Deutscher Meister im Science Slam. Im Interview erklärt er, wie Virtual Reality das Gehirn anspricht und warum virtuelle Klassenzimmer so wichtig sind. Dabei erläutert er die komplexe Wissenschaft stets unterhaltsam und verständlich. Am 1. Februar 2018 hält er auf der LEARNTEC seine Keynote »Lernst Du noch oder verstehst…
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security
Datenschutz im Krisenmodus: Vier Länder verbessern sich – viele verschlechtern sich

Eine länderübergreifende Analyse durch Datenschutzexperten zeigt: 2024 war ein Rückschritt für den Datenschutz in Europa. 130.000 Verstöße in 15 Nationen – davon über 27.800 in Deutschland. Nur 4 Länder verzeichnen Rückgänge bei den Verstößen. 5,9 Mrd. € Bußgelder seit DSGVO-Start – Irland führt vor Deutschland und Österreich. Die Datenschutzexperten von heyData, einer B2B-Plattform für digitale…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Logistik
KI- und ML-basiertes Aufbereiten und Analysieren: Big Data als Chance nutzen

Große Datenmengen stellen für Unternehmen eine immer größere Herausforderung dar. Unterstützt von cloudbasierten Daten- und Orchestrierungsplattformen bieten sie jedoch auch wertvolle Chancen. Vor allem der Einsatz von KI- und ML-basierten Technologien erweist sich für das Aufbereiten und Analysieren großer Datenmengen als hilfreich. Hochentwickelte Technologien wie KI und ML haben das Potenzial, die weltweiten Lieferketten in…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Lösungen | Strategien
Die Psychologie der Identitätssicherheit: Was menschliche Neigungen so riskant macht

Bei einem Vorfall aus dem Jahr 2024 büßte ein einzelnes Unternehmen über 25 Millionen Dollar ein. Der Grund: Ein Angestellter war Opfer eines Deep-Fake-Impersonation-Angriffs geworden. Der Videoanruf, ausgelöst durch eine Phishing-E-Mail, hatte dem betreffenden Mitarbeiter vorgegaukelt, er habe es mit vertrauten Kollegen zu tun. [1] Solche Angriffe manipulieren die menschliche Psychologie. Und wie das Beispiel…
News | Business Process Management | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Daten in modernen KI-Umgebung brauchen Leitplanken und keine Schranken

Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert weiterhin die Geschäftswelt und hilft Unternehmen, Aufgaben zu automatisieren, Erkenntnisse zu gewinnen und Innovationen in großem Umfang voranzutreiben. Doch es bleiben Fragen offen, vor allem wenn es um die Art und Weise geht, wie KI-Lösungen Daten sicher verarbeiten und bewegen. Einem Bericht von McKinsey zufolge gehören Ungenauigkeiten in der KI sowie…
News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
Zurückhaltung gegenüber KI im Kundenservice

In einer Gartner-Studie aus dem Jahr 2024 gaben zwei Drittel der Befragten an, dass Kunden zögern, wenn es um den Einsatz von KI im Kundenservice geht [1]. Dies stellt Unternehmen vor ein Dilemma, da sie zunehmend auf KI setzen, um Kosten zu senken, Einblicke in Geschäftsprozesse zu gewinnen und mit innovativen Technologien auf dem neuesten…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps | Whitepaper
Datensicherheit: KI macht Mitarbeiter zu Insider-Bedrohungen

GenAI-Daten-Uploads steigen innerhalb eines Jahres um das 30-fache; drei von vier Unternehmen nutzen Apps mit integrierten genAI-Funktionen. Netskope, ein Unternehmen für moderne Sicherheit und Netzwerke, hat eine neue Studie veröffentlicht, die einen 30-fachen Anstieg der Daten zeigt, die von Unternehmensanwendern im letzten Jahr an generative KI-Apps (genAI) gesendet wurden [1]. Dazu gehören sensible Daten…
News | Digitalisierung | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Strategien | Whitepaper
GenAI-Boom trotz Krise: Unternehmen investieren weiter

KI-Einführung geschieht meist ohne das nötige Adoption & Change Management. Deutsche Social Collaboration Studie 2025 zeigt: Knapp die Hälfte der Unternehmen nutzen bereits GenAI. Knapp 43 Prozent erwarten schnelle Amortisation der Projekte. Frontline Worker beim digitalen Arbeitsplatz oft abgehängt. Die Firmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz investieren in GenAI-Erweiterungen des digitalen Arbeitsplatzes…
Trends 2025 | News | Business Process Management | Trends Services | Künstliche Intelligenz
Generative KI könnte Produktivität in der Softwareentwicklung um bis zu 74 Prozent steigern

Fehlende Priorisierung von Tests und mangelnde Integration generativer KI-Tools sorgen für Bedenken, vor allem wegen des zunehmenden Drucks durch KI-Agenten. Über die Hälfte der Software-Profis ist überzeugt, dass Gen-AI-Tools ihre Produktivität deutlich steigern. Dennoch geben 23 Prozent an, dass ihre Entwicklungsumgebung (IDE) keine integrierten Gen AI-Tools enthält. Fast zwei Drittel der Nutzer, die 2025 generative…
Trends 2025 | News | Business | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | New Work
Künstliche Hybris: Mehrheit hält sich für unersetzlich

Jeder dritte Beschäftigte nutzt generative künstliche Intelligenz für berufliche Zwecke. Deutliche Mehrheit hält die eigene berufliche Tätigkeit nicht durch KI ersetzbar. Unternehmen müssen laut EU AI Act seit Februar 2025 KI-Weiterbildungen anbieten, wenn sie die Technologie nutzen. Hannover Messe im Zeichen von KI in der Industrie. Der Einfluss von künstlicher Intelligenz (KI) auf die…
Trends 2025 | News | Künstliche Intelligenz | Services | Whitepaper
KI in Europa: Achtung, Fertig, Los?

Europa hinkt in Sachen künstliche Intelligenz (KI) hinterher. Technologische Supermächte wie die USA und China haben einen klaren Vorsprung, insbesondere im Bereich der Large Language Models (LLMs) wie ChatGPT, Copilot oder Deepseek. Aber Europa erwacht langsam aus seinem Dornröschenschlaf, wie verschiedene Initiativen zeigen. Ein wichtiger Meilenstein hierbei ist das europäische Finanzierungsprogramm für KI: Mehr…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Services | Whitepaper
Höhere Investitionen: Hersteller setzen verstärkt auf KI in der Produktentwicklung

Künstliche Intelligenz (KI) prägt die Zukunft der Produktentwicklung entscheidend. 80 Prozent der Industrieunternehmen arbeiten bereits mit KI-Technologien in diesem Bereich und 91 Prozent planen, ihre Investitionen in den nächsten zwei Jahren zu erhöhen. Das sind zentrale Ergebnisse der Aras-Studie »Die Zukunft der Produktentwicklung – Product Lifecycle Management im Fokus«, für die 656 Führungskräfte in den…
News | E-Commerce | Künstliche Intelligenz | Marketing
Modernes Marketing: Marketer-Kreativität und KI-Innovation

KI hält unvermindert Einzug in die verschiedensten Lebens- und Arbeitsbereiche. Wie können Unternehmen mit KI im Marketing gänzlich neue Chancen nutzen? Im Marketing ist es Status quo, dass Fachleute ihre Kampagnen aufwendig manuell entwerfen und durchführen. Mit KI stehen jetzt aber die Werkzeuge zur Verfügung, um in großem Umfang datengesteuert und automatisiert zu arbeiten.…
