
Illustration Absmeier foto freepik ki
Die Diskussion um künstliche Intelligenz konzentriert sich zunehmend auf Kontrolle und Compliance. Besonders in Europa spielt das Konzept der souveränen KI eine zentrale Rolle: Unternehmen und Behörden sollen leistungsstarke Modelle einsetzen können, ohne ihre Datenhoheit oder die Einhaltung regulatorischer Vorgaben zu gefährden.
Die globale Digitalökonomie erlebt derzeit eine Phase tiefgreifender Neuorientierung. Handelsstreitigkeiten oder fragile Lieferketten haben in den vergangenen Jahren gezeigt, wie verwundbar Unternehmen tatsächlich sind. In puncto künstliche Intelligenz geht es um die Frage, wer die Kontrolle über Daten, Modelle und Infrastrukturen besitzt und wer damit letztlich über Innovationsfähigkeit, Sicherheit und Wettbewerbsstärke entscheidet. Souveräne KI beschreibt genau diesen Anspruch: Die Fähigkeit, Systeme unabhängig zu entwickeln und zu betreiben, ohne sich zu sehr auf einzelne Anbieter und Plattformen verlassen zu müssen. Ziel ist es, strategische Risiken zu reduzieren, technologische Handlungsfähigkeit zu bewahren und gleichzeitig die Resilienz zu erhöhen.
Aus Sicht von Dell Technologies profitieren diese Branchen und Bereiche besonders von souveräner KI:
- Öffentliche Hand.
Während EU-Staaten wie Estland oder Finnland zeigen, wie effizient und bürgernah eine digitale Verwaltung funktionieren kann, kämpft Deutschland vielerorts noch mit Papierakten, Insellösungen und komplizierten Antragsverfahren. Die Bürger erwarten heute jedoch einen Service, der so unkompliziert und schnell ist wie eine Online-Bestellung: digitale Formulare statt Warteschlangen, automatisierte Freigaben statt monatelanger Bearbeitungszeiten – und das von der Kfz-Zulassung über Baugenehmigungen bis hin zur Unternehmensgründung. In Bezug auf die IT-Infrastruktur sind KI-gestützte Fachverfahren und skalierbare Cloud-Umgebungen dafür unabdingbar. Damit rückt gleichzeitig aber auch die Frage nach der digitalen Souveränität in den Mittelpunkt. Bürger und Unternehmen wollen ihre sensiblen Daten zu Recht geschützt wissen. Eine übermäßige Abhängigkeit von nicht-europäischen Technologieanbietern birgt nicht nur Risiken, sondern kann im Ernstfall auch die staatliche Handlungsfähigkeit einschränken. Ein souveräner Ansatz garantiert, dass personenbezogene Informationen innerhalb geschützter Bereiche bleiben, was Vertrauen schafft. - Medizin und Forschung.
Künstliche Intelligenz ist längst Teil des medizinischen Alltags. Die Technologie erkennt Muster, die für das menschliche Auge schwer sichtbar sind, und ermöglicht so frühzeitige und präzisere Diagnosen. Ein automatisierter Befund ist aber nur einer der Vorteile. Ein weiterer ist die Möglichkeit der personalisierten Medizin. Anstatt wie früher eine Standardbehandlung für alle Patienten anzuwenden, rückt die personalisierte Medizin den einzelnen Menschen mit seinen genetischen, biologischen und lebensstilbedingten Merkmalen in den Mittelpunkt. Besonders in der Onkologie, wo das gezielte Ansprechen genetischer Mutationen über den Erfolg oder Misserfolg einer Therapie entscheiden kann, eröffnet diese datenbasierte Medizin völlig neue Möglichkeiten: von der Auswahl der wirksamsten Chemo über personalisierte Immuntherapien bis hin zu innovativen Ansätzen in der Wirkstoffentwicklung. Patientendaten gehören jedoch zu den sensibelsten Informationen überhaupt. Souveräne KI-Ansätze ermöglichen es Krankenhäusern, Forschungseinrichtungen und Gesundheitsbehörden, Daten sicher zu verarbeiten und auszuwerten, ohne diese in unsichere Umgebungen zu übertragen. - Finanzbranche.
Zu den Branchen, die KI bereits intensiv nutzen, gehören Banken und Versicherer – sei es in der Kundenberatung, der Risikoprüfung oder der Betrugserkennung. KI-Algorithmen können kriminelle Transaktionen beispielsweise in kürzester Zeit erkennen und so Verbraucher und Institutionen gleichermaßen schützen. Sie können auch personalisierte Finanzberatung und Risikomanagement-Tools unterstützen und Dienstleistungen somit zugänglicher und sicherer machen. Gleichzeitig unterliegt kaum eine Branche so strengen und vielfältigen Auflagen wie der Finanzsektor. Banken, Versicherungen und Kapitalmarktakteure müssen sich in einem Umfeld behaupten, das von nationalen und internationalen Regelwerken geprägt ist – von der Geldwäscheprävention über Datenschutzvorgaben bis hin zur Stärkung der Cyberresilienz. Souveräne KI bietet hier einen Ausweg: Sie erlaubt die Nutzung leistungsfähiger Modelle, ohne dass Daten in nicht-europäische Umgebungen ausgelagert werden müssen. Finanzinstitute profitieren so von Echtzeit-Analysen und automatisierten Entscheidungen, während sensible Informationen unter ihrer Kontrolle bleiben. - Industrie.
Die industrielle Produktion ist zunehmend datengetrieben. Mithilfe von KI sind heute Anwendungen wie die vorausschauende Wartung, die visuelle Qualitätskontrolle und die Automatisierung kompletter Fertigungsschritte möglich und schaffen damit entscheidende Wettbewerbsvorteile. Gleichzeitig lässt sich mithilfe von GenAI die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine auf eine zuvor nicht gekannten Weise vereinfachen. Roboter erhalten ihre Anweisungen nicht mehr nur über komplexe Codebefehle, sondern direkt in natürlicher Sprache, die das System eigenständig umsetzt. Auch in der Qualitätssicherung eröffnet die Technologie neue Wege. Anstatt aufwendig große Mengen an Bildern von realen Defekten zu sammeln, können Trainingsdaten mithilfe synthetisch erzeugter Bildvarianten ergänzt oder vollständig simuliert werden. Dadurch lernen KI-Systeme, selbst kleinste Fehler wie feine Risse in Werkstoffen oder Unregelmäßigkeiten in Beschichtungen zu erkennen. Was jedoch gerne vergessen wird: Fertigungsunternehmen arbeiten mit sensiblen Daten, die Patente, Produktionsgeheimnisse und anderes geistiges Eigentum enthalten. Diese dürfen nicht frei zugänglich sein. Eine souveräne KI hält alle Informationen sicher innerhalb des eigenen Zuständigkeitsbereichs und schützt sie vor unbefugtem Zugriff.
»Ein überstürztes, unüberlegtes Handeln ist nie ein guter Ratgeber – auch nicht in Fragen der digitalen Souveränität. Wer über souveräne Technologien spricht, muss weder seine Systeme komplett abschotten noch muss er KI-Modelle in Eigenregie entwickeln. Vielmehr geht es darum, zu verstehen, welche Abhängigkeiten bestehen, wo Risiken lauern und an welchen Punkten sich ein gesundes Maß an Autonomie herstellen lässt. Unternehmen, die ein KI-Modell über offene APIs einbinden, bewegen sich durchaus im rechtlichen Rahmen, solange sie die Funktionsweise, Datenflüsse und rechtlichen Rahmenbedingungen ihrer Lösung nachvollziehen und steuern können. In Branchen wie dem Gesundheitswesen wiederum wird mit besonders sensiblen Informationen gearbeitet, weshalb Datenschutz und Compliance extrem wichtig sind und Souveränität einen ganz anderen Stellenwert hat«, betont Tim van Wasen, Geschäftsführer von Dell Technologies DACH. »Nur wer seine Abhängigkeiten kennt, kann sie strategisch managen. Souveräne KI ist jedoch keineswegs eine Alles-oder-nichts-Entscheidung, sondern ein Balanceakt zwischen Kontrolle, Effizienz und Innovationsfreiheit.«
In welchen konkreten Schritten kann ein Unternehmen digitale Souveränität erlangen?
Hier ein pragmatischer, umsetzbarer Fahrplan mit Prioritäten, Verantwortlichkeiten und Quick‑wins, den ein Unternehmen in 6–12 Monaten starten und in 18–36 Monaten operationalisieren kann.
- Ausgangslage bestimmen: Inventar, Risiko, Zielniveau
-
- Erstelle ein vollständiges Inventar aller Daten, Systeme und Dienstleister (Cloud, SaaS, APIs).
- Kategorisiere Assets nach Sensitivität, Compliance‑Anforderungen und strategischem Wert.
- Definiere das gewünschte Souveränitätsniveau je Anwendungsfall (voll lokal, hybrid, Cloud mit Kontrollmechanismen). Diese Bestandsaufnahme ist die Basis für alle folgenden Maßnahmen und verhindert Über‑ oder Unterschutz von Systemen.
- Governance, Verantwortlichkeiten und Policies etablieren
-
- Richte ein klares Governance‑Gremium (CIO/CISO, Legal, Compliance, Fachbereich) ein.
- Entwickle verbindliche Policies zu Datenhoheit, Anbieter‑Risiko, Verschlüsselung, Access‑Management und Exit‑Klauseln in Verträgen.
- Implementiere Review‑Zyklen für neue KI‑ und Cloud‑Projekte. Governance macht Souveränität messbar und steuerbar und verhindert Insellösungen.
- Architekturprinzipien: Modular, hybrid, interoperabel
-
- Setze auf hybride Architektur: sensible Daten und Modelle lokal oder in zertifizierten EU‑Jurisdiktionen; weniger sensitive Workloads in Public Cloud.
- Verwende Standard‑APIs, offene Formate und klare Datenflüsse, um Vendor‑Lock‑in zu vermeiden.
- Plane für vertrauliches Rechnen / Confidential Computing für sensible Workloads. Diese Balance zwischen lokalem Betrieb und globaler Innovation ist Kern einer praktikablen Souveränitätsstrategie.
- Datenmanagement und technische Controls
-
- Klassifiziere und segmentiere Daten; verschlüssele Daten in Ruhe und in Bewegung.
- Implementiere Data‑Loss‑Prevention, feingranulares IAM (Zero Trust) und Audit‑Logging.
- Führe Data Provenance, Metadaten‑Management und Retention/Deletion‑Mechanismen ein. Sichere Datenflüsse und Nachvollziehbarkeit sind Voraussetzung, damit Modelle mit sensiblen Daten arbeiten dürfen.
- Lieferantenmanagement und Vertragsgestaltung
-
- Beurteile Anbieter nach Transparenz, Standort der Datenverarbeitung, Zertifizierungen und Exit‑Optionen.
- Verhandle vertraglich: Datenhoheit, Audit‑Rechte, Subprocessor‑Listen, SLA‑Garantien, Rückführungs‑/Löschklauseln.
- Priorisiere Partner mit EU‑Hosting/Operations oder nachweisbarer Interoperabilität. Strategische Partnerschaften mit klaren Kontrollrechten minimieren Abhängigkeitsrisiken.
- Aufbau interner Kompetenzen und Organisation
-
- Schaffe Rollen: Data‑Steward, ML‑Ops/Platform Engineers, Security for AI, Legal/Privacy‑Specialist.
- Investiere in Training (Sicherheit, Datenschutz, Modell‑Risiko) und in ein kleines KI‑/Cloud‑Platform‑Team zur Orchestrierung.
- Fördere enge CIO–CEO‑Abstimmung, damit Souveränität als Geschäftsstrategie statt IT‑Klausel verstanden wird.
- Pilotprojekte und Skalierung (quick wins)
-
- Starte 1–2 Pilotfälle mit hohem Risiko/hohem Wert (z. B. Patientendaten‑Analyse, Betrugserkennung) im hybriden Setup.
- Verwende diese Piloten, um technische Patterns, Verträge und Betriebsprozesse zu validieren.
- Überführe erfolgreiche Designs in eine wiederverwendbare Platform‑Roadmap (Templates, IaC, Compliance‑Pipelines). Praxisnahe Piloten liefern schnelle Erkenntnisse und reduzieren langfristige Implementationsrisiken.
- Audit, Monitoring und kontinuierliche Verbesserung
-
- Etabliere laufendes Monitoring für Data‑Flows, Kosten, Provider‑Risiken und Compliance‑Metriken.
- Plane regelmäßige Audits, Penetrationstests und Model‑Bias/Robustness‑Reviews.
- Passe Policies und Architektur iterativ an neue Regularien und Marktveränderungen an. Transparente Monitoring‑ und Audit‑Prozesse halten Souveränität langfristig aufrecht.
Prioritätencheck (Kurzfristig → Mittelfristig)
- Sofort (0–6 Monate): Inventar, Risikoklassifikation, Governance, kritische Vertragsklauseln.
- Mittelfristig (6–18 Monate): Hybrid‑Architektur, Pilotprojekte, erste Plattform‑Bausteine.
- Langfristig (18–36 Monate): Skalierung, Confidential Computing, vollständige Betriebs‑/Audit‑Maturität und Lieferanten‑Diversifizierung.
Knackpunkte, die Entscheider beachten sollten
- Souveränität ist kein Alles‑oder‑Nichts: Wahlfreiheit zwischen lokalem Betrieb und globaler Innovation ist entscheidend.
- Technologie allein reicht nicht; Vertragliche und organisatorische Maßnahmen sind genauso wichtig.
- Investitionen in People und Prozesse sind langfristig wirksamer als rein technische Projekte.
Souveräne KI bedeutet Kontrolle über Daten, Modelle und Infrastruktur, ohne einseitige Abhängigkeit von einzelnen Anbietern.
Davon profitieren verschiedene Gruppen unterschiedlich — technisch, rechtlich und wirtschaftlich — weil souveräne Lösungen Vertraulichkeit, Regulierungs‑Compliance und strategische Unabhängigkeit bieten.
Wer profitiert und warum
- Öffentliche Verwaltung Grund: Schutz sensibler Bürgerdaten, Einhaltung nationaler Rechtsvorgaben und größere Handlungsspielräume bei kritischen Diensten (z. B. digitale Behördenprozesse).
- Gesundheitswesen und Forschung Grund: Verarbeitung hochsensibler Patientendaten für Diagnostik, personalisierte Medizin und Wirkstoffforschung ohne Datenexfiltration; fördert Vertrauen und Forschungsskalierung innerhalb geschützter Umgebungen.
- Finanzbranche (Banken, Versicherer) Grund: strenge Regulierungen verlangen Transparenz, Datenhoheit und Auditierbarkeit; souveräne KI ermöglicht Betrugserkennung, Risikomanagement und Echtzeit‑Analysen bei gleichzeitigem Schutz sensibler Finanzdaten.
- Industrie und produzierendes Gewerbe Grund: Schutz von geistigem Eigentum, Produktionsgeheimnissen und sensiblen Sensordaten; souveräne KI unterstützt Predictive Maintenance, visuelle Qualitätskontrolle und sichere Automatisierung ohne Auslagerungsrisiken.
- KMU mit Compliance‑Ansprüchen Grund: Möglichkeit, leistungsfähige KI zu nutzen, ohne Geschäftsgeheimnisse oder Kundendaten an Drittanbieter zu übergeben; erhöht Risikokontrolle und Wettbewerbsfähigkeit.
- Staatliche Sicherheits‑ und Kritische‑Infrastruktur‑Betreiber Grund: Sicherstellung nationaler Resilienz, Vermeidung externer Abhängigkeiten und Schutz vor geopolitischen Risiken, die den Betrieb beeinträchtigen könnten.
- Endnutzer und Bürger Grund: Besserer Datenschutz, nachvollziehbare Nutzung persönlicher Daten und größeres Vertrauen in digitale Dienste, wenn sensible Informationen lokal oder innerhalb kontrollierter Jurisdiktionen bleiben.
Wesentliche Gründe, warum Souveränität Mehrwert schafft
- Datenhoheit reduziert strategische Risiken und Abhängigkeiten.
- Compliance und regulatorische Nachvollziehbarkeit werden einfacher sicherzustellen.
- Innovationsfähigkeit bleibt erhalten, weil Wahlfreiheit zwischen globalen Innovationen und lokalem Betrieb besteht.
Konkrete Empfehlungen für Entscheider (kurz und praktisch)
- Priorisieren: Anwendungsfälle nach Sensitivität und Compliance‑Risiko bewerten.
- Architektur: hybride Modelle wählen (Cloud + lokal) und klare Datenflüsse definieren.
- Governance: Verantwortlichkeiten, Audit‑ und Kontrollmechanismen einführen.
- Partnerwahl: auf Interoperabilität, Auditierbarkeit und Exit‑Optionen achten.
Albert Absmeier & KI
836 Artikel zu „KI Souveränität“
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services | Strategien
KI-Souveränität: Deutsche Telekom startet eine der größten KI-Fabriken Europas

Die Deutsche Telekom und NVIDIA bauen gemeinsam eine der größten KI-Fabriken Europas in München, die im ersten Quartal 2026 in Betrieb gehen soll. Diese »Industrial AI Cloud« wird deutschen Unternehmen ermöglichen, ihre KI-Modelle und -Anwendungen mit proprietären Daten weiterzuentwickeln und bietet eine um 50 Prozent erhöhte KI-Rechenleistung. Die Partnerschaft umfasst eine Investition von über einer…
News | Kommentar | Künstliche Intelligenz
KI-Souveränität bedeutet Wahlmöglichkeit in einem globalen Ökosystem

Souverän ist, wer Wahlfreiheit hat – nicht, wer alles selbst baut. In der KI-Entwicklung bedeutet das: Globale Innovationen nutzen, aber lokal kontrollieren, sagt Tim van Wasen, Geschäftsführer DACH bei Dell Technologies. Kaum ein Begriff taucht derzeit so häufig in europäischen Strategiepapieren auf wie »souveräne KI«. Doch je öfter er fällt, desto wichtiger wird es,…
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Strategien | Ausgabe 5-6-2025
Cloud-Souveränität 2025 – Zwischen Regulierung, KI und technischer Realität
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Souveränität: KI als Trojanisches Pferd

Wie ein simples Präsidenten-Dekret Europa den KI-Stecker ziehen könnte. Über digitale Souveränität wurde schon viel geschrieben, aber der Begriff bleibt häufig abstrakt. Was er bedeutet, hat Donald Trump vor Kurzem beim Internationalen Strafgerichtshof demonstriert. Er hat dem Chefankläger Karim Khan den Zugang zu seinem Microsoft-E-Mail-Account gekappt, seine britischen Bankkonten gesperrt und US-Bürgern mit Verhaftung…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Strategien
Stargate und die Streichung der KI-Regulierung sind eine Gefahr für die europäische Wirtschaft und Technologiesouveränität

Donald Trump streicht die bestehenden Vorgaben zur Kontrolle von künstlicher Intelligenz in den USA und kündigt ein 500 Milliarden Investment in die Technologie an. Damit gerät Europa weiter in Gefahr: Die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit ist ernsthaft beeinträchtigt, führende KI-Denker wandern ab und Europa wird seine Technologiesouveränität nicht mehr sicherstellen können. Ein Statement von KI-Experte Carsten Kraus.…
News | Blockchain | IT-Security | Kommunikation | Strategien
Dynamische Datensperren – Wie KI und Blockchain Governance neu definieren
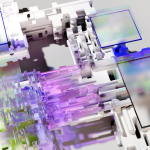
https://www.pexels.com/de-de/foto/abstrakt-technologie-forschung-digital-17485707/ Die klassische Welt der Datenhaltung kennt zentrale Datenbanken, Sperr- oder Negativlisten und manuelle Prozesse für Widerruf oder Löschung. Doch im Zeitalter von künstlicher Intelligenz und Blockchain- bzw. Distributed-Ledger-Technologien verändert sich das Fundament von Speicherung, Nutzung und Kontrolle personenbezogener Daten grundlegend. Statt rein zentral gesteuerter Sperrmechanismen entstehen Architekturen aus dezentraler, kryptografisch gestützter Zugriffskontrolle, ergänzt durch…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Zollchaos: KI-gestützte Planungstools verhelfen zu variablen Lieferketten
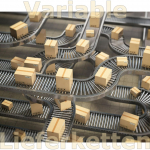
KI-gestützte Planungstools können hohe Zölle zwar nicht verhindern, aber ihre negativen Auswirkungen minimieren. Zölle rauf, Zölle runter, Zölle verschoben, dann die Einigung auf 15 Prozent, aber nur wenn Deutschland genügend in den USA investiert [1]. Der nicht enden wollende Zickzackkurs der US-Regierung erhöht nicht nur die Kosten, er droht auch etablierte Lieferketten abreißen zu lassen…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI als Fluch und Segen für die Cybersecurity-Landschaft

Wer profitiert eigentlich mehr von den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz – die Security-Verantwortlichen oder die Kriminellen? Was wiegt schwerer: das Risiko, Opfer von KI-getriebenen Angriffen zu werden – oder die Gefahr, sich zu sehr auf KI-Schutzsysteme zu verlassen? Ein aktuelles Stimmungsbild. KI ist in der Cybersecurity zugleich Hoffnungsträger und Risikoquelle. Laut einer TÜV-Studie vermuten…
News | Business | Digitalisierung | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Bias in der KI erkennen und reduzieren: IDnow bringt Forschungserkenntnisse in die Praxis
Im Rahmen des EU-geförderten Projekts MAMMOth zeigt IDnow, wie sich Verzerrungen in KI-Systemen erkennen und reduzieren lassen – ein wichtiger Schritt hin zu vertrauenswürdiger digitaler Identitätsprüfung. Das EU-geförderte Projekt MAMMOth (Multi-Attribute, Multimodal Bias Mitigation in AI Systems) hat nach drei Jahren intensiver Arbeit zentrale Ergebnisse zur Verringerung von Verzerrungen in KI-Systemen veröffentlicht [1]. Gefördert…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
5 Hindernisse beim Aufbau eines flüssigkeitsgekühlten KI-basierten Rechenzentrums (AIDC)

Wie Anwender die komplexe Infrastruktur von AIDCs der nächsten Generation in der Praxis meistern können. Aufgrund der rasanten Entwicklung KI-basierter Technologien der nächsten Generation, wie GenAI und AI4S (KI für die Wissenschaft), müssen Rechenzentren Workloads bewältigen, die noch vor wenigen Jahren unvorstellbar waren. Allerdings stellen der deutsche Branchenverband Bitkom und nationale Studien fest, dass die…
News | Digitalisierung | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Deutschland hinkt bei KI hinterher – doch es gibt Hoffnung

Der neue Cisco AI Readiness Index 2025 [1] zeichnet ein ernüchterndes Bild: Nur 12 Prozent der deutschen Unternehmen sind optimal auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz vorbereitet. Während Deutschland im europäischen Vergleich zwar auf Platz 2 liegt, hinken fast zwei Drittel der Unternehmen noch hinterher. Besonders alarmierend: Lediglich 32 Prozent sind im kritischen Bereich »Daten«…
Trends 2025 | News | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Mehrwert durch KI: Realizing the Value of AI

Um Wert aus KI zu schöpfen, braucht es mutige Ziele und belastbare Grundlagen. Der Cisco AI Readiness Index zeigt, dass eine kleine, aber beständige Gruppe von Unternehmen — die »Pacesetter« — über alle Kennzahlen hinweg besser abschneidet [1]. Etwa 13 % der Organisationen weltweit fallen seit drei Jahren in diese Kategorie. Pacesetter schaffen es…
Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025 | News | Cloud Computing | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Strategien
Souveräne, skalierbare und zukunftssichere IT-Lösungen – »Digitale Souveränität ist eine Notwendigkeit, kein Trend«

Wo Sicherheit, Resilienz und digitale Souveränität zentrale Anforderungen sind, brauchen Organisationen einen vertrauenswürdigen Partner mit fundierter Erfahrung und Technologiekompetenz für skalierbare, hochverfügbare, interoperable IT-Systeme. Im Interview erklärt Matthias Moeller, CEO von Arvato Systems und Bertelsmann CIO warum der Grad an Souveränität immer zum konkreten Anwendungsfall passen muss.
News | Business | Digitale Transformation | Geschäftsprozesse | Trends 2030 | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Mit welchen Entwicklungen sollte man bei KI bis 2030 rechnen?

Bis 2030 ist mit einer beschleunigten Verbreitung von generativer KI und agentischen Systemen, starker Marktfragmentierung, tiefgreifenden Veränderungen im Arbeitsmarkt und verschärfter Regulierung zu rechnen. Technologische Entwicklungen Generative KI und KI‑Agenten werden Mainstream‑Produktivitätstools herausfordern und beträchtliche Marktverschiebungen auslösen; Anbieter werden Funktionen neu packen und Preismodelle anpassen. Multiagenten‑Systeme werden Routine‑CRM‑ und Serviceprozesse weitgehend automatisieren, Menschen bleiben für…
News | TechTalk | IT-Security
TechTalk: Die KI bietet neue Angriffsvektoren und schützt gleichzeitig davor

Während der großen Security-Veranstaltung it-sa 2025 durften wir mit Jörg von der Heydt vom Sicherheitsanbieter Bitdefender an unserem Messestand dieses Videointerview führen. Darin spricht er über den scheinbaren Widerspruch, der sich aus dem Einsatz von KI-Techniken und -Anwendungen und einer erforderlichen und gewünschten digitalen Souveränität ergibt. Und klar, dass uns auch interessierte, wie sich mögliche Risiken bestmöglich umgehen und vermeiden lassen. Herausgekommen ist dieses zweieinhalb minütige Video, in dem der Sicherheitsexperte Risiken und Möglichkeiten von Cloud und KI beleuchtet und aufzeigt.
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Trends Security | Trends Infrastruktur | Trends Cloud Computing | Trends Kommunikation | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | Strategien
Technologietrends für 2026: Innovation und Transformation in einer KI-gesteuerten, hypervernetzten Welt

Die strategischen Technologietrends für 2026 umfassen KI-Supercomputing-Plattformen, Multiagentensysteme, domänenspezifische Sprachmodelle, KI-Sicherheitsplattformen, KI-native Entwicklungsplattformen, vertrauliches Rechnen, physische KI, präventive Cybersicherheit, digitale Herkunft und Geopatriation. Diese Trends treiben Innovation und Transformation in einer KI-gesteuerten, hypervernetzten Welt voran [1]. »2026 wird ein entscheidendes Jahr für Technologieführer, in dem Disruption, Innovation und Risiken in einem nie dagewesnen Tempo…
Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025 | News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI und Cyberresilienz: Die Zukunft der IT-Sicherheit – Cyberresilienz als strategische Priorität

Kathrin Redlich, Vice President DACH & CEE bei Rubrik, betont die Notwendigkeit von Cyberresilienz in Unternehmen, da Cyberangriffe unvermeidlich sind. Dabei ist die schnelle Wiederherstellung der Geschäftskontinuität nach einem Angriff entscheidend für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Die Integration von KI in Sicherheitslösungen wird eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Cyberangriffen spielen.
News | Business | Effizienz | Strategien
IT-Strategien für Kostenkontrolle und Souveränität
Ausgabe 9-10-2025 | News | Business | Künstliche Intelligenz | Lösungen
Die Bedeutung visueller Kollaborationsplattformen für die KI-Transformation in Unternehmen – Vom Whiteboard zum KI-Hub

Die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen ist Herausforderung und Chance zugleich. Um Unabhängigkeit und Flexibilität zu gewährleisten, müssen Nutzerschnittstellen, Rohdaten und Feature-Daten voneinander getrennt und standardisierte Schnittstellen genutzt werden. Visuelle Kollaborationsplattformen mit tiefer KI-Integration bieten eine innovative Lösung, indem sie multimodale, kollaborative Arbeitsräume schaffen, die die kognitiven Prozesse der Nutzer fördern.
News | Business | Digitale Transformation | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Strategien | Tipps
CIO-CEO-Alignment: Gemeinsam zum Erfolg im KI-Zeitalter

CEOs verlangen messbaren Geschäftswert aus KI bei gleichzeitigem Druck auf Kosten und Risiko. CIOs müssen die CEO-Prioritäten verstehen, sechs entscheidende Gesprächsfelder beherrschen und konkrete Governance- und Kommunikationsmuster etablieren, um Modernisierung und Innovation zu ermöglichen. Ausgangslage und Kernprobleme Abstimmungsdefizite: Viele CIOs sind unsicher, welche Prioritäten der CEO tatsächlich setzt, und fühlen sich in strategischen Entscheidungen…

