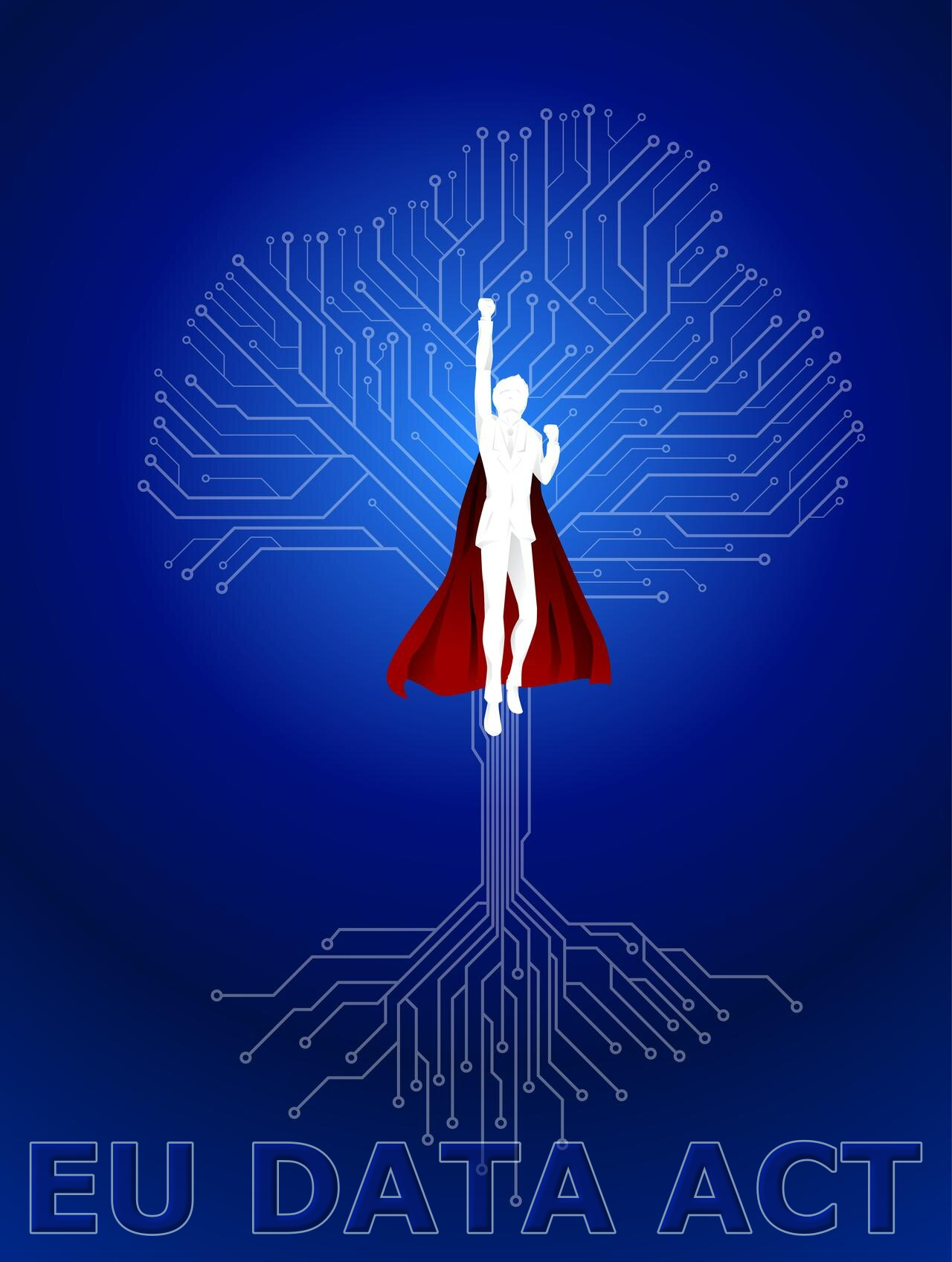
Illustration Absmeier foto freepik
Der EU Data Act ist eine Verordnung, die den Zugang zu und die Nutzung von Daten innerhalb der Europäischen Union regelt. Ziel ist es, ein faires und transparentes Datenökosystem zu schaffen, in dem Unternehmen und Verbraucher mehr Kontrolle über die von ihnen generierten Daten erhalten.
Wann tritt der Data Act in Kraft?
Der Data Act wurde am 11. Januar 2024 verabschiedet und tritt nach einer Übergangsfrist am 12. September 2025 in Kraft. Ab diesem Datum müssen Unternehmen die neuen Vorschriften vollständig umsetzen.
Welche Auswirkungen hat der Data Act auf Unternehmen?
Der Data Act bringt weitreichende Veränderungen für Unternehmen mit sich:
- Mehr Transparenz und Datenzugang: Unternehmen müssen sicherstellen, dass Nutzer Zugriff auf die von ihnen generierten Daten haben und diese weitergeben können.
- Regeln für Cloud-Dienste: Der Wechsel zwischen Cloud-Anbietern wird erleichtert, um Monopole zu verhindern.
- Neue Vertragsklauseln: Unternehmen müssen ihre Verträge anpassen, um den fairen Austausch von Daten zu gewährleisten.
- Erhöhte Compliance-Anforderungen: Verstöße gegen den Data Act können zu hohen Geldstrafen führen.
- Chancen für datengetriebene Geschäftsmodelle: Unternehmen können von neuen Möglichkeiten profitieren, indem sie Daten effizienter nutzen und vermarkten.
- Viele Unternehmen sind jedoch noch nicht ausreichend vorbereitet. Laut einer Umfrage haben erst 5 % der deutschen Unternehmen einzelne Vorgaben des Gesetzes umgesetzt, während 82 % noch keine Maßnahmen getroffen haben.
Der Data Act könnte die Wettbewerbsfähigkeit in Europa stärken, aber auch Herausforderungen mit sich bringen. Unternehmen müssen sich frühzeitig mit den neuen Anforderungen auseinandersetzen, um rechtzeitig compliant zu sein.
Maßnahmen für die Umsetzung
Die praktische Umsetzung des EU Data Act erfordert eine strategische Herangehensweise, um die neuen Vorschriften effizient in Unternehmensprozesse zu integrieren. Hier sind einige bewährte Maßnahmen:
- Dateninventur und Analyse
Unternehmen sollten zunächst eine Bestandsaufnahme ihrer Daten durchführen. Dabei geht es um:
- Welche Daten werden gesammelt?
- Wer hat Zugriff darauf?
- Wie werden sie gespeichert und verarbeitet?
- Anpassung von Verträgen
Der Data Act bringt neue Anforderungen an Datenzugangsrechte und Cloud-Dienste. Unternehmen sollten ihre Verträge mit Kunden und Partnern überprüfen und anpassen, um den neuen Regelungen zu entsprechen.
- Compliance-Strategie entwickeln
Es ist ratsam, eine interne Richtlinie für den Umgang mit Daten zu erstellen. Dazu gehören:
- Klare Regeln für die Datenweitergabe
- Mechanismen zur Einhaltung der Vorschriften
- Schulungen für Mitarbeiter
- Technische Infrastruktur optimieren
Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre IT-Systeme die neuen Anforderungen erfüllen. Dazu gehört:
- Sichere Speicherung und Verwaltung von Daten
- Interoperabilität zwischen verschiedenen Plattformen
- Möglichkeit zum Wechsel zwischen Cloud-Anbietern
- Schulungen für Mitarbeiter
Die neuen Vorschriften betreffen viele Abteilungen. Schulungen helfen, das Bewusstsein für Datenrechte und -pflichten zu schärfen und Fehler zu vermeiden.
- Zusammenarbeit mit Experten
Da der Data Act komplex ist, kann es sinnvoll sein, Rechts- und IT-Experten hinzuzuziehen, um eine reibungslose Umsetzung zu gewährleisten.
Fazit
Unternehmen sollten frühzeitig mit der Umsetzung beginnen, um rechtliche Risiken zu vermeiden und die Chancen des Data Act optimal zu nutzen. Möchtest du mehr über spezifische Branchen oder praktische Beispiele erfahren?
Genki Absmeier
Kaum ein Unternehmen ist auf den Data Act vorbereitet
Erst 5 Prozent haben einzelne Vorgaben umgesetzt. Wirtschaft will Datennutzung massiv ausweiten: In zwei Jahren will knapp jedes zweite Unternehmen stark vom datengetriebenen Geschäft profitieren. 16 Prozent bieten bereits heute Daten auf Datenmärkten an – in Zukunft wollen 59 Prozent dort aktiv sein.
In etwas mehr als 100 Tagen müssen die Unternehmen den Data Act umgesetzt haben – doch die große Mehrheit der Unternehmen hat sich damit noch überhaupt nicht beschäftigt. Nur 1 Prozent hat die Vorgaben vollständig umgesetzt, weitere 4 Prozent zumindest teilweise. 10 Prozent haben gerade erst mit der Umsetzung begonnen, 30 Prozent haben noch nicht damit angefangen. Und mehr als die Hälfte (52 Prozent) glaubt, dass sie vom Data Act nicht betroffen ist. Das sind Ergebnisse einer Befragung von 605 Unternehmen in Deutschland ab 20 Beschäftigten aus allen Branchen im Auftrag des Digitalverbands Bitkom[1].
»Der Data Act betrifft so gut wie jedes Unternehmen, aber die meisten haben sich damit noch gar nicht ernsthaft befasst«, sagt Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst. »Beim Data Act darf sich das Drama der Datenschutzgrundverordnung nicht wiederholen. Die DSGVO ist durch jahrelange Unsicherheiten und Umsetzungsschwierigkeiten zu einem echten Innovationshemmer geworden. Das Management muss jetzt aufwachen und die Politik muss besser unterstützen.«
Dies sei auch deshalb wichtig, weil die deutsche Wirtschaft die Nutzung von Daten deutlich ausweiten will. Während heute nur in rund einem Viertel (27 Prozent) der Unternehmen datengetriebene Geschäftsmodelle ausschließlich oder stark zum Geschäftserfolg beitragen, soll der Anteil bereits in zwei Jahren bei 47 Prozent liegen. »Die deutsche Wirtschaft sitzt auf einem Datenschatz – und immer mehr Unternehmen machen sich auf den Weg, diesen auch zu heben«, sagt Wintergerst. Zugleich haben 12 Prozent der Unternehmen bei datengetriebenen Geschäftsmodellen nach eigenem Dafürhalten den Anschluss verpasst, vor einem Jahr waren es noch 19 Prozent. 8 Prozent haben sich mit dem Thema noch gar nicht befasst, nach 15 Prozent im Vorjahr.
Umsetzung des Data Act verursacht hohen Aufwand
Der EU Data Act wurde im November 2023 beschlossen und wird nach einer Übergangsfrist ab 12. September 2025 anwendbar. Er beinhaltet eine Vielzahl von unterschiedlichen Regelungen, die etwa den Wechsel von Cloud-Anbietern erleichtern sollen. Er macht aber auch Vorgaben für Vertragsklauseln rund um Daten und gibt vor allem Nutzerinnen und Nutzern sowie Dritten Rechte an Daten von vernetzten Geräten.
Die Umsetzung des Data Act erzeugt für die meisten Unternehmen hohen Aufwand und blockiert Ressourcen zum Beispiel für die Entwicklung von Innovationen. Jene Unternehmen, die sich selbst vom Data Act betroffen sehen oder sich bereits in der Umsetzung befinden, beklagen weit überwiegend den hohen Aufwand. 32 Prozent sprechen von einem sehr hohen Umsetzungsaufwand, 34 Prozent von einem eher hohen. Drei Viertel (75 Prozent) dieser Unternehmen sagen, dass durch die Umsetzung des Data Act die Zeit für Innovationen fehlt. 9 von 10 (90 Prozent) fühlen sich von den vielen neuen Gesetzen und Anforderungen überfordert. Und ebenfalls 90 Prozent fordern mehr Beratung durch öffentliche Stellen bei der Umsetzung des Data Act.
»Nicht nur die Unternehmen, auch die Politik muss beim Data Act ihre Hausaufgaben machen. Wer Regulierung beschließt, muss auch die Betroffenen ausreichend informieren und unterstützen. Der letzten Bundesregierung ist es in eineinhalb Jahren nicht einmal gelungen, jene Behörde zu benennen, die die Umsetzung des Data Act beaufsichtigen soll«, so Wintergerst. »Das muss die neue Regierung umgehend nachholen. Daten sind in vielen Bereichen entscheidend für den Geschäftserfolg, ob bei Training und Nutzung von KI, in der Medizintechnik oder in der Automobilbranche.«
Datenökonomie: Mehrheit sieht Deutschland noch als Nachzügler
Zwei Drittel (67 Prozent) der Unternehmen erwarten, dass datengetriebene Geschäftsmodelle für Wachstum und Wohlstand von Volkswirtschaften künftig eine große Rolle spielen werden. Aktuell sehen aber nur 6 Prozent die deutsche Wirtschaft hier unter den Vorreitern, 34 Prozent im Mittelfeld und 51 Prozent unter den Nachzüglern. 6 Prozent glauben sogar, dass Deutschland den Anschluss verpasst habe. Als führend gelten vor allem die USA (32 Prozent) und China (28 Prozent). Dahinter folgen mit deutlichem Abstand Japan (12 Prozent) und Südkorea (7 Prozent). »Als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt muss unser Anspruch sein, auch in der Datenökonomie einen Spitzenplatz zu belegen«, so Wintergerst.
Nur 7 Prozent der Unternehmen nutzen das Potenzial der ihnen bereits zur Verfügung stehenden Daten vollständig aus, weitere 30 Prozent nutzen es zumindest eher stark. Umgekehrt sagen 41 Prozent, dass sie die Möglichkeiten eher wenig ausschöpfen, 19 Prozent sogar überhaupt nicht. Von diesen haben aber bereits 26 Prozent Maßnahmen ergriffen, um Daten künftig besser zu nutzen, weitere 49 Prozent planen das derzeit.
Datengeschäft steht vor einem Boom
Das Geschäft mit Daten wird in Deutschland in den kommenden Jahren voraussichtlich massiv ausgeweitet. Heute sind bereits 41 Prozent der Unternehmen auf Datenmärkten als Datenabnehmer aktiv, 16 Prozent bieten dort Daten an. Allerdings wollen weitere 34 Prozent künftig auf Datenmärkten Daten beziehen und 43 Prozent Daten anbieten. Die Zahl der Datenabnehmer könnte so künftig auf 75 Prozent und die der Datenanbieter auf 59 Prozent steigen. »In wenigen Jahren wird jedes zweite Unternehmen in Deutschland eigene Daten bereitstellen«, sagt Wintergerst. Während heute noch 54 Prozent der Unternehmen auf Datenmarktplätzen überhaupt nicht aktiv sind, schließen das mit Blick auf die Zukunft derzeit nur noch 17 Prozent aus.
Unternehmen, die keine Daten anbieten, werden nach eigenen Angaben durch den Datenschutz davon abgehalten. Er erlaube in ihrem Fall keinen Datenaustausch, sagen 56 Prozent. 42 Prozent sind unsicher, ob ein Datenteilen rechtlich möglich ist, 31 Prozent haben Sorge, dass versehentlich Geschäftsgeheimnisse weitergegeben werden. Bei 28 Prozent sind die Daten nicht kompatibel und 24 Prozent sorgen sich, dass andere Staaten die bereitgestellten Daten gegen uns einsetzen. 19 Prozent haben Schwierigkeiten bei der Einigung mit potenziellen Partnern, für 16 Prozent ist das Datenangebot wirtschaftlich nicht attraktiv und 13 Prozent wollen Wettbewerber nicht stärken. 12 Prozent kennen schlicht keine passenden Abnehmer.
»Eine Datenökonomie braucht Rechtssicherheit und eine Regulierung, die datengetriebene Geschäftsmodelle aktiv fördert«, so Wintergerst.
Bekannte Datenräume sind beispielsweise Catena-X im Automotive-Bereich oder Manufacturing-X für die industrielle Lieferkette. Solche Datenräume werden aktuell allerdings nur von 9 Prozent der Unternehmen genutzt, weitere 18 Prozent haben das geplant und 22 Prozent diskutieren darüber. Für ein Drittel (33 Prozent) sind Datenräume kein Thema, 15 Prozent haben davon noch nichts gehört. Fast die Hälfte (46 Prozent, 2024: 39 Prozent) sagt, dass Datenräume ihrem Unternehmen ganz neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. 58 Prozent gehen davon aus, dass mit Datenräumen der Einsatz Künstlicher Intelligenz vorangetrieben wird (2024: 49 Prozent). Zugleich beklagen 47 Prozent (2024: 42 Prozent), dass Datenräume noch zu kompliziert sind für den Einsatz im Unternehmen. 49 Prozent wünschen sich, dass die Politik Datenräume stärker fördert (2024: 55 Prozent). Rund ein Drittel (37 Prozent, 2024: 32 Prozent) hält Datenräume dagegen für irrelevant für das eigene Geschäftsmodell, 23 Prozent (2024: 22 Prozent) sehen durch Datenräume das eigene Geschäftsmodell bedroht.
Unternehmen beziehen vielfältige Daten – und brauchen noch mehr
Dabei greifen viele Unternehmen bereits heute auf das Daten-Angebot Dritter zu. So nutzen 76 Prozent auf diese Weise bezogene Marktdaten, 66 Prozent Kunden- und Kontaktdaten. Dahinter folgen Geodaten (46 Prozent) und Daten aus den Bereichen Verwaltung (39 Prozent), Finanzen und Wirtschaft sowie Mobilität (je 38 Prozent), Social Media (28 Prozent), Technologie (27 Prozent), Umwelt- und Wetter (26 Prozent), Maschinen (24 Prozent) und Gesundheit (5 Prozent). Fragt man die Unternehmen, welche Daten ihnen fehlen, so liegen Social-Media-Daten vorne (39 Prozent), gefolgt von Verwaltungsdaten (27 Prozent), Kunden- und Kontaktdaten (25 Prozent), Finanz- und Wirtschaftsdaten (24 Prozent), Technologiedaten (22 Prozent), Geodaten (19 Prozent), Umwelt- und Wetterdaten sowie Maschinendaten (je 18 Prozent), Gesundheitsdaten (14 Prozent), Marktdaten (13 Prozent) und Mobilitätsdaten (12 Prozent). »Wir brauchen funktionierende Datenmarktplätze, damit Unternehmen jene Daten beziehen können, die sie benötigen«, so Wintergerst. »Auch die öffentliche Hand ist aufgerufen, Daten zur Verfügung zu stellen. Die verantwortungsvolle Nutzung von Daten schafft wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Mehrwert, auf den wir nicht verzichten dürfen.«
Praxishilfen zum Data Act
Zum Data Act hat Bitkom eine Reihe von Publikationen veröffentlicht, unter anderem einen Leitfaden »Chancen im Data Act«. Alle Informationen online hier: www.bitkom.org/Themen/Data-Act
[1] Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom durchgeführt hat. Dabei wurden 605 Unternehmen in Deutschland ab 20 Beschäftigten telefonisch befragt. Die Befragung fand im Zeitraum von KW 10 bis KW 16 2025 statt. Die Umfrage ist repräsentativ.
KI- und ML-basiertes Aufbereiten und Analysieren: Big Data als Chance nutzen

Illustration Absmeier foto freepik
Große Datenmengen stellen für Unternehmen eine immer größere Herausforderung dar. Unterstützt von cloudbasierten Daten- und Orchestrierungsplattformen bieten sie jedoch auch wertvolle Chancen. Vor allem der Einsatz von KI- und ML-basierten Technologien erweist sich für das Aufbereiten und Analysieren großer Datenmengen als hilfreich.
Hochentwickelte Technologien wie KI und ML haben das Potenzial, die weltweiten Lieferketten in ihrer Performance grundlegend zu verbessern. Durch Echtzeitüberwachung entlang der gesamten Lieferkette und in den Partnernetzwerken kann die KI- und ML-gestützte Software mögliche Anomalien zuverlässig erkennen, Ergebnisse anhand verschiedener Lösungsansätze bewerten und selbstständig Korrekturmaßnahmen ergreifen. Laut einer Untersuchung von Gartner1 werden bis 2025 mindestens die Hälfte der Großunternehmen KI-basierte Orchestrierungsplattformen einsetzen. Das sind 40 Prozent mehr als 2020, wo die Quote noch bei weniger als 10 Prozent lag. Doch trotz der zum Teil hohen Investitionen in KI- und ML-Projekte, fielen die Geschäftsergebnisse bei 85 Prozent der befragten Unternehmen niedriger aus als geplant. Das liegt zu einem großen Teil daran, dass viele Industriebetriebe immer noch veraltete Systeme im Einsatz halten, die für KI-Implementierung nicht oder nur unvollständig ausgelegt sind.
Damit Lieferketten die erwarteten Ergebnisse liefern, müssen sie eine Plattform nutzen, mit der sich große Informationsmengen in Sekundenbruchteilen verarbeiten lassen. Neben einheitlichen Governance- und Compliance-Funktionen sollte die Plattform daher auch Funktionen für Echtzeit-Einblicke aus dem unternehmensübergreifenden Netzwerk sowie aus Drittquellen enthalten. Auf diese Weise können Unternehmen Echtzeit-Daten system- und standort- sowie partnerübergreifend aufnehmen und analysieren und vorhandene Datensilos aufbrechen.
Mit einer leistungsstarken Supply-Chain-Plattform allein ist es jedoch nicht getan. In vielen Unternehmen fehlt auch die notwendige Infrastruktur und Kapazität, um die sehr großen Datenmengen von Lieferanten, Kunden, Partnern oder Drittanbietern, die täglich verarbeitet werden müssen, zu sammeln, zu harmonisieren, zu analysieren und für die tägliche Entscheidungsfindung zu nutzen. Sie arbeiten beispielsweise mit jahrzehntealten Datenbanken, verwenden Offline-Algorithmen oder verlassen sich auf Systeme, die innerhalb von Datensilos operieren. Zudem sind die Daten häufig immer noch über die gesamte Lieferkette in verschiedenen Einzellösungen verteilt und zentral nicht abrufbar und verwertbar. Industriebetriebe, die jedoch nicht in der Lage sind, Echtzeitdaten zu Nachfrageänderungen, Lagerbeständen, Produktverfügbarkeit und anderen Schlüsselfaktoren zuverlässig zu erfassen und zu nutzen, werden keine präzisen Aussagen treffen können und das Potenzial ihrer Lieferkette nicht ausschöpfen. Die Folgen sind Fehleinschätzungen und falsche Entscheidungen mit den entsprechenden geschäftlichen Konsequenzen.
Barrieren für den Datenzugriff abbauen
Einige KI-Daten-Cloud-Spezialisten bieten Unternehmen seit einiger Zeit vollständig verwaltete, sichere Plattformen für die Datenkonsolidierung an. Durch Kooperation mit einer ergänzenden Partner-Supply-Chain-Lösung, erhalten Kunden und Partner einen zentralen Zugang zu einem zentralen Datenmarktplatz. Sie können so beispielsweise ihre internen Daten mit Live-Datenprodukten von Drittanbietern – von Rohstoffpreisen bis hin zu Wettermustern – anreichern, ihre Szenarien präziser planen und fundiertere Geschäftsentscheidungen treffen. Die Ergebnisse werden anschließend in einem semantischen Datenmodell logisch abgebildet und in ein Format umgewandelt, das von Cloud-nativen Diensten problemlos genutzt werden kann. Bis zu 20 Milliarden Machine-Learning-Workloads führen einige dieser Supply-Chain-Plattformen täglich aus. Viele Systeme verwenden eine relationale KI als semantische Schicht, die LLMs und Agenten den notwendigen sprachbasierten Kontext zu den zugrunde liegenden Daten liefert.
Da die Daten an einem zentralen Ort, der Single-Source auf Truth, gespeichert werden, greifen alle Anwender auf einen einheitlichen Datenbestand zu und können so über das gesamte Ökosystem der Lieferkette hinweg synchronisiert zusammenarbeiten. Mittels Datenkollaborationsfunktionen, welche die Partner-Lösung zur Verfügung stellt, können Teams auch von unterschiedlichen Standorten und Systemen aus auf Daten zugreifen und so ihre KI-Modelle gemeinsam erstellen, trainieren und kontinuierlich verfeinern. Beispielsweise können sie über die gesamte Lieferkette hinweg die zukünftigen Bedarfe für Produkte und Dienstleistungen abschätzen, Bestände verwalten oder Artikel für die Auslieferung vorbereiten.
Geringere Kosten durch einen zentralen Datenspeicher
Der Zugriff auf einen zentralen Datenspeicher verringert nicht nur die Latenzen zwischen Lieferanten, Kunden, Partnern oder Drittanbietern signifikant, er reduziert auch die Komplexität und den Zeitaufwand für Datenumwandlungen. Durch die reduzierte Datenmenge und -bewegung sowie der niedrigen Latenz können Unternehmen so – trotz hoher Investitionen in innovative Technologien wie KI oder ML – ihre Gesamtkosten deutlich reduzieren.
Transparente, durchgängige Sicht auf die gesamte Supply-Chain
Durch die gemeinsame Datennutzung erhalten Anwender weltweit eine transparente durchgängige Sicht auf die Supply-Chain und können nahezu in Echtzeit über Anwendungen hinweg zusammenarbeiten. Durch das Zusammenführen von Echtzeitdaten aus dem gesamten Supply-Chain-Ökosystem, inklusive Lieferanten und deren Lieferanten (N-Tier), ist es für Anwender zudem möglich, Ausnahmen schneller zu identifizieren und bei Bedarf umgehend Maßnahmen einzuleiten. Unternehmen können so die gesamte Lieferkette nahezu in Echtzeit orchestrieren und synchronisieren unter Berücksichtigung aller Faktoren, die Einfluss auf ihre Betriebskosten und Ergebnisse haben – unabhängig, ob sie vorgelagert, nachgelagert oder extern sind.
Gabriel Werner, Global Field CTO bei Blue Yonder
Gabriel Werner ist Experte für Supply Chain Management, Automatisierung und künstliche Intelligenz in der Lieferkette. Mit seinem Team deckt er die gesamte Wertschöpfungskette im Supply Chain Management ab, von der Planung bis zur Steuerung. Gabriel Werner hilft Kunden aus der industriellen Fertigung, Logistik und Retail bei der Digitalisierung ihrer Lieferketten. Vor seiner jetzigen Tätigkeit war er als Vice President Manufacturing für die DACH-Region und Vice President of Solutions Advisory für Blue Yonder in der EMEA-Region tätig. Er kam im April 2011 als Senior Solutions Advisor zu Blue Yonder und unterstützte Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Lieferkettenleistung durch den Einsatz von Technologie. Er durchlief verschiedene Rollen, u.a. die des Vice President. Seit 2024 ist er als Global Field CTO branchenübergreifend für alle Blue Yonder Industrien verantwortlich.
1 https://www.gartner.com/en/documents/4006740
Was regelt der neue Data Act der EU?
Der neue Data Act der EU, der am 11. Januar 2024 in Kraft getreten ist, stellt einen bedeutenden Schritt in der Gestaltung der digitalen Zukunft Europas dar. Dieses Gesetz ist ein zentraler Bestandteil der europäischen Datenstrategie und wird einen wesentlichen Beitrag zu den Zielen des digitalen Jahrzehnts leisten, indem es die digitale Transformation vorantreibt.
Der Data Act zielt darauf ab, fairen Zugang zu Daten und deren Nutzung zu harmonisieren. Er enthält Regelungen für den Datenaustausch zwischen Unternehmen (B2B), zwischen Unternehmen und Verbrauchern (B2C), sowie zwischen Unternehmen und öffentlichen Stellen (B2G). Eine der Hauptfunktionen des Data Acts ist es, die Datenweitergabe zu erleichtern und gleichzeitig die Rechte der Nutzer zu stärken und den Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten.
Einige der spezifischen Bestimmungen des Data Acts umfassen:
- Vorschriften zur Datenweitergabe von Unternehmen an Verbraucher und zwischen Unternehmen.
- Pflichten der Dateninhaber, die nach EU-Recht verpflichtet sind, Daten bereitzustellen, einschließlich Regelungen zur Entlohnung im B2B-Bereich.
- Das Verbot missbräuchlicher Vertragsklauseln für den Datenzugang und die Datennutzung zwischen Unternehmen.
- Die Bereitstellung von Daten für öffentliche Stellen in Fällen von außergewöhnlicher Notwendigkeit.
- Vertragliche Regelungen und technische Umsetzung beim Wechsel zwischen Datenverarbeitungsdiensten, bekannt als »Cloud Switching«.
Der Data Act wird auch dazu beitragen, die Wertschöpfung zu steigern, insbesondere für neue Geschäftsmodelle, Start-ups und KMUs. Durch die Förderung einer besseren Nutzung von Daten in verschiedenen Lebensbereichen unterstützt das Gesetz das Ziel der Bundesregierung, durch mehr Datennutzung mehr Wertschöpfung zu erzielen.
Für Verbraucher bedeutet der Data Act niedrigere Preise für Anschlussmarktdienste und Reparaturen intelligenter Geräte, da sie nun die Freiheit haben, Reparaturen von einem Anbieter ihrer Wahl durchführen zu lassen. Unternehmen erhalten neue Möglichkeiten zur Nutzung von Diensten, die den Zugang zu Daten voraussetzen, und der öffentliche Sektor erhält Zugang zu Daten des privaten Sektors, um auf Katastrophen wie Überschwemmungen und Waldbrände reagieren zu können.
Insgesamt wird der Data Act der EU dazu beitragen, eine faire und innovative Datenwirtschaft zu schaffen, die sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen zugutekommt. Mit einer Übergangsfrist von 20 Monaten wird der Data Act ab dem 12. September 2025 EU-weit direkt anwendbares Recht sein. Dies markiert einen wichtigen Meilenstein in der europäischen Gesetzgebung, der die Art und Weise, wie Daten in der EU gehandhabt werden, grundlegend verändern wird.
Genki Absmeier
2828 Artikel zu „EU Data Act“
News | Business | Cloud Computing | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services | Strategien
Kann sich Europa überhaupt von den US-Cloud-Giganten trennen?

Angesichts der jüngsten politischen Veränderungen in den USA suchen Unternehmen in der EU nach Wegen, sich von den großen US-Cloud-Anbietern unabhängiger zu machen. Die Trennung wird aber nicht einfach sein. Seit Jahren verlassen sich europäische Unternehmen auf die US-amerikanischen Cloud-Giganten Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud, um ihre Daten zu hosten,…
News | Infrastruktur | Produktmeldung | Rechenzentrum | Services
IT mit digitalem Zwilling managen: Drei neue Funktionen in DC Vision machen Infrastrukturmanagement noch effizienter

Pünktlich zur Data Centre World in Frankfurt stellt DC Smarter drei neue Funktionen der KI-basierten Software DC Vision vor: Ab sofort lassen sich auch Netzwerkkabel im digitalen Zwilling abbilden, Racks können zunächst digital hinzugefügt und anschließend physisch erfasst werden. Zusätzlich wird der Servicestatus von DCIM, KI und der Infrastrukturservices in Echtzeit angezeigt. Live-Demos auf der…
News | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services
Beobachtbarkeit von KI-Daten: Die wichtigsten Trends und Best Practices für Datenverantwortliche

Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) verändern Unternehmen in einem noch nie dagewesenen Tempo. Dennoch fällt es vielen Datenverantwortlichen schwer, ihren KI-gestützten Erkenntnissen zu vertrauen, da die Daten nicht ausreichend beobachtbar sind. Tatsächlich vertrauen nur 59 % der Unternehmen ihren KI/ML-Modelleingaben und -ausgaben, wie die jüngste BARC Data Observability Studie »Observability for AI…
News | Business | Strategien | Tipps
Wie man ein technologieorientiertes ETF-Portfolio von Grund auf neu aufbaut

Erfahren Sie, wie Sie im Jahr 2025 ein profitables ETF-Portfolio mit Fokus auf Technologie aufbauen können. Entdecken Sie die besten deutschen ETFs und Expertentipps für langfristigen Erfolg. Der Aufbau eines Anlageportfolios von Grund auf könnte das fehlende Bindeglied zwischen Ihren finanziellen Zielen und der Realität sein. Die meisten Anleger bevorzugen eine Mischung von Vermögenswerten,…
News | Blockchain | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien
Deutschland im KI-Wettlauf: Chancen nutzen, Risiken minimieren, Infrastrukturen bereitstellen

Künstliche Intelligenz (KI) ist die Schlüsseltechnologie für Innovationen, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit. Wie können deutsche Unternehmen die Chancen von KI nutzen, mutig voranschreiten und bestehende Hürden bei der breiten Umsetzung überwinden? Auf dem 14. Frankfurter Symposium für Digitale Infrastruktur am 22.05.2025 in der Union Halle wurden diese Themen gerade diskutiert und konkrete Handlungsempfehlungen erarbeitet. Dabei standen…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Kommentar | Strategien
»Kauf europäisch« ist nicht genug – digitale Souveränität gibt es nur mit Open Source Software

Standpunkt von Peter Ganten, Vorstandsvorsitzender der Open Source Business Alliance – Bundesverband für digitale Souveränität. Nie war deutlicher als in diesen Tagen, wie kritisch es um unsere digitale Souveränität steht. Der von den USA ausgelöste internationale Zollkrieg tobt, geopolitische Krisen bestimmen die Politik, und die USA sind längst kein verlässlicher Partner mehr, sondern verhalten sich…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien | Whitepaper
Strategie: Wie Deutschland zum KI-Hotspot werden kann

Bitkom legt 10-Punkte-Vorschlag zu Einsatz und Entwicklung von künstlicher Intelligenz vor. Wintergerst: »Bei künstlicher Intelligenz muss die Zeit des Abwartens vorbei sein«. Bei künstlicher Intelligenz muss Deutschland gleich zu Beginn der neuen Legislaturperiode den Schalter umlegen und sich als internationaler KI-Standort etablieren. Dafür hat der Digitalverband Bitkom jetzt einen konkreten Fahrplan mit zehn Empfehlungen…
News | Business | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | New Work | Strategien
Neue Rolle der IT: Technologie-Expertise gehört in das C-Level
Zur neuen zentralen Rolle der IT in Unternehmen. Spätestens seit dem Digitalisierungsschub der Corona-Jahre hat sich die Rolle der IT-Abteilungen in den Unternehmen grundlegend geändert: In modernen Unternehmen sind sie weit mehr als ein reiner Technik-Support für die Fachabteilungen. IT gilt heute als Enabler für neue Geschäftsmodelle. Ganze Branchen würden ohne IT als treibender…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Zwei Drittel der deutschen Unternehmen können ihre »Shadow AI«-Tools nicht absichern

In Unternehmen kommen mehr als 80 Maschinenidentitäten auf eine menschliche Identität. Sicherheitsbedenken hinsichtlich des Einsatzes von KI und KI-Agenten sind in Deutschland sehr hoch. Die meisten deutschen Unternehmen waren bereits Opfer von Cyberangriffen. CyberArk, Anbieter von Identity Security, hat mit dem »CyberArk 2025 Identity Security Landscape Report« eine neue globale Studie veröffentlicht [1]. Diese…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | E-Commerce | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Logistik | Tipps
Volatile Zölle beeinflussen die Lieferketten – Wie ereignisgesteuerte IT-Systeme Herstellern in turbulenten Zeiten helfen

Wie man stets rechtzeitig und nie kontraproduktiv handelt: Fünf IT-Tipps für den effektiven Umgang mit Schwankungen in der Lieferkette. Die jüngsten politischen Unsicherheiten und die Schwankungen im Welthandel, insbesondere die sich schnell ändernden Zölle der Trump-Regierung, haben globale Lieferketten in den Fokus gerückt: Wie schnell kann Ihre Lieferkette reagieren? Das aktuelle Tempo der politischen…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien
Asilab stellt das heutige Verständnis von künstlicher Intelligenz in Frage: Asinoid lernt und entwickelt sich weiter wie das menschliche Gehirn

Forschungsinstitut und Technologieunternehmen Asilab hat eine neue Art von künstlicher Intelligenz (KI) entwickelt, basieren auf der Architektur des menschlichen Gehirns. Im Gegensatz zu künstlicher Intelligenz, die auf großen Sprachmodellen (Large Language Models oder LLM) basiert, richtet sich Asilabs patentierte Asinoid-Technologie auf echte, sich kontinuierlich selbst verbessernde Kognition. Gegründet von Mitgliedern des erfolgreichen Unternehmens AppGyver sucht…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Künstliche Intelligenz
Jedes zweite Unternehmen in Deutschland plant Start-up-Kooperationen für seine KI-Strategie

75 Prozent der Unternehmen sehen Start-ups als KI-Schlüsselpartner – tatsächliche Umsetzung bleibt hinter Ambitionen zurück. 64 Prozent verfügen über eine eigene Open-Innovation-Abteilung. 51 Prozent der Unternehmen in Deutschland wollen ihre KI-Strategie künftig gemeinsam mit Start-ups entwickeln. Das zeigt der »Open Innovation Report 2025« von Sopra Steria, Ipsos und der INSEAD Business School, für den…
News | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz | Strategien
Wie entwickelt sich KI in der deutschen Wirtschaft?

Bis 2022 hat künstliche Intelligenz in der deutschen Wirtschaft kaum eine Rolle gespielt. Damals war KI nur in neun Prozent aller Unternehmen im Einsatz, weitere 25 Prozent planten oder diskutierten den Einsatz. Aber mittlerweile hat das Thema Fahrt aufgenommen, wie aktuelle Zahlen des Digitalverbands Bitkom zeigen. Denen zufolge setzt mittlerweile jedes fünfte Unternehmen auf KI,…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien
Wie weit ist die Einführung von KI in deutschen Unternehmen?

Reifegrad, Anwendungen, Investitionen und Gewinnerwartungen beim KI-Einsatz in großen Unternehmen. EPAM Systems, ein Unternehmen für digitale Transformation, Dienstleistungen und Produktentwicklung, hat im April 2025 seinen KI-Forschungsbericht »From Hype to Impact: How Enterprises Can Unlock Real Business Value with AI« veröffentlicht [1]. Der Bericht basiert auf einer Umfrage unter 7.300 Teilnehmern (Deutschland: 856 Teilnehmer) aus Unternehmen…
News | Digitalisierung | Infrastruktur | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
Alles wird anders: Wie KI auch die Telekommunikation neu gestaltet

Längst ist klar: Künstliche Intelligenz ist der Gamechanger, der in sämtlichen Branchen und Berufen neue Dimensionen eröffnet. Für manchen überraschend: Auch die Telekommunikation steht vor einem fundamentalen Wandel. Erste bahnbrechende Anwendungen etablieren sich bereits als unverzichtbar im Geschäftsalltag. Bevor wir tiefer in die Welt der automatischen Transkription eintauchen, lohnt sich ein kurzer Blick zurück:…
News | Trends 2024 | Business | Trends Mobile | Trends Services | Services
Streaming verhilft Musikindustrie zu neuen Höhen

Die weltweite Musikindustrie hat 2024 einen neuen Rekordwert von rund 29,6 Milliarden US-Dollar (nicht inflationsbereinigt) erwirtschaftet. Laut dem jüngsten Global Music Report der International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) ist der Umsatz gegenüber 2023 um rund fünf Prozent angestiegen [1]. Dies ist das zehnte Jahr in Folge, in dem die weltweite Musikindustrie ein Wachstum…
News | Business | New Work | Tipps
Fehlbesetzungen kosten Geld, Zeit und Nerven: Schnell besetzt – und später bereut?

Wie können Unternehmen trotz Fachkräftemangels langfristig erfolgreich bleiben? Denn der trifft Betriebe aller Größen und Branchen hart. Er bremst die Produktion, belastet den Vertrieb und lähmt die Verwaltung – und in letzter Konsequenz beeinträchtigt er die Stimmung in Unternehmen. Im Stellenmanagement steigt folglich der Druck, schnell zu handeln. Doch Eile kann sich negativ auswirken. »Hauptsache…
Ausgabe 3-4-2025 | Security Spezial 3-4-2025 | News | IT-Security
Schritt-für-Schritt-Anleitung und Best Practices – Threat Models richtig erstellen

Threat Models (Bedrohungsmodelle) ermöglichen es Organisationen, Sicherheitsrisiken frühzeitig zu erkennen und gezielt zu bekämpfen – noch bevor diese ausgenutzt werden können. Indem Systeme aus der Perspektive potenzieller Angreifer analysiert werden, lassen sich kritische Schwachstellen identifizieren und priorisieren.
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Geschäftsprozesse
HR 2.0 mit No-Code- und Low-Code: Personalverwaltung neu gedacht

Wie No-Code- und Low-Code-Plattformen HR-Prozesse umfassend automatisieren. In einer zunehmend digitalisierten Welt eröffnen KI und maschinelles Lernen HR ganz neue Möglichkeiten. Lediglich Bewerbungen zu verwalten war gestern. Zukünftig werden Systeme auch Talente in sozialen Netzwerken identifizieren oder proaktiv Mitarbeiterfluktuationen verhindern. Dank automatisierter, integrierbarer Lösungen könnte sich das Personalwesen dabei vom Stiefkind zum strategischen Treiber im…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Strategien
Europas digitale Souveränität beginnt bereits in der Grundschule

Ein Kommentar von Christian Gericke, Geschäftsführer der d.velop mobile services GmbH, Chief of Public Affairs bei d.velop und Vizepräsident des Bundesverbands IT-Mittelstand e.V. (BITMi) Digitale Souveränität ist ein Schlagwort, das zwar gerne und häufig in politischen Reden und Strategiepapieren verwendet, in der Praxis aber fast immer viel zu kurz gedacht wird. Schnell geht es…